1.2 Scheinbare Helligkeit
In der Antike hat der Astronom Hipparch (ca. 190 – 125 v. Ch.) ein System entwickelt, Sterne anhand ihrer Helligkeit am Himmel einzuteilen. Hierbei bezeichneten er die hellsten Sterne als 1. Größe und die gerade noch sichtbaren als Sterne 6. Größe. Natürlich ist die Sichtbarkeit der Sterne an der scheinbaren Himmelskugel nicht nur von der Leuchtkraft der Sterne, sondern auch von deren Entfernung zum Betrachter abhängig. Aufgrund dessen spricht man von scheinbarer Helligkeit, die auf keinen Fall als echte Zustandsgröße betrachtet werden darf, da ein Stern der sehr weit von der Erde entfernt, dafür aber eine enorm hohe Leuchtkraft besitzt, immer noch heller erscheinen kann, als ein benachbarter Stern mit geringer Strahlungsleistung im sichtbaren Bereich.
Um bei der Neuerung der Einteilung von Sternen nach deren scheinbaren Helligkeit auf die alten Statistiken zurückgreifen zu können, versuchte man sich dem antiken System so weit wie möglich an zu nähern. Als Formelzeichen für die scheinbare Helligkeit verwendet man auch heute noch m oder magn, was sich von dem lateinischen Wort „magnitudo“ (zu deutsch: Größe) ableiten lässt.
Wie bei allen Größen benötigt man auch hier einen Bezugspunkt zu allen anderen Sternen. Diesen „Nullpunkt“ stellt in diesem Fall der Stern Wega dar. Als Stern 0. Größer ist er ein sehr heller Stern und die scheinbaren Helligkeiten anderer Sterne lassen sich aus deren Strahlungsstrom S, also der Strahlungsleistung pro Flächeneinheit, die auf der Erdoberfläche wahrgenommen werden können, berechnen.
Scheinbare Helligkeit m: 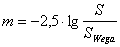
Bsp.: 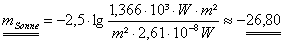
(Für den Fall der Sonne beträgt der Strahlungsstrom S Sonne die Solarkonstante S=1,366 kW/m² )
Das Erscheinen des Logarithmus in der Gleichung für die scheinbare Helligkeit ist eine zwangsläufige Folge des psycho-physischen Gesetzes, welches besagt, dass der Mensch Reize, die er mit den Augen aus seiner Umgebung aufnimmt, nicht in einer linearen, sondern einer logarithmischen Abfolge wahrnimmt. Ganz einfach lässt sich diese Gesetzmäßigkeit mit einem Experiment belegen. Schaut man zuerst auf eine Kerze und danach auf zwei Flammen, so wird man einen deutlichen Unterschied wahrnehmen. Entzündet man aber 100 Kerzen und danach 101 so wird man nahezu keine Veränderung bemerken. Die gleiche Wirkung, wie die aus dem Experiment mit der geringen Kerzenanzahl, wird sich erst dann einstellen, wenn man in die Flammen von 200 Kerzen blickt. Da man außerdem, wie bereits oben erwähnt, die neue Einteilung relativ genau an die bereits Bestehende von Hipparch anpassen wollte, fügte man außerdem noch den Faktor -2,5 hinzu.
Da jedoch Wega mit Nichten den hellsten Stern am Himmel darstellt, ergibt sich für einige Sterne, beispielsweise Sirius, der uns mit -1, m 44 neben der Sonne am hellsten erscheint, eine negative scheinbare Helligkeit, wobei m zur besseren Identifizierung der Magnitude in Exponentenschreibweise erscheint.